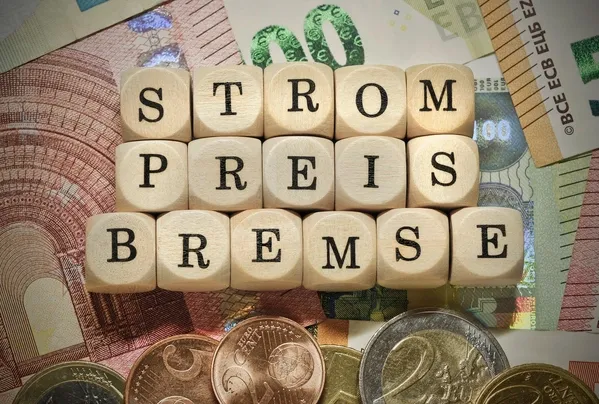Strompreisentwicklung Österreich: Wie entsteht der Strompreis?
Der Strompreis ist für viele Haushalte und Unternehmen in Österreich ein wesentlicher Kostenfaktor. Warum er sich ständig verändert, ist jedoch nicht auf den ersten Blick erkennbar. Tatsächlich hängt die Preisbildung von einer Vielzahl an Prozessen und Rahmenbedingungen ab – von der Stromerzeugung über die Netzinfrastruktur bis hin zu politischen Entscheidungen und globalen Ereignissen. Wenn Sie die Mechanismen kennen, verstehen Sie besser, warum sich Preise entwickeln, wie sie es eben tun.
Kurz zusammengefasst:
Der Strompreis entsteht aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage am Energiemarkt. Maßgeblich ist dabei die sogenannte Merit-Order, nach der zuerst günstige und erst danach teurere Energiequellen eingesetzt werden. Für Endkundinnen und Endkunden setzt sich der Strompreis aus drei Hauptbestandteilen zusammen: Energiekosten, Netzgebühren sowie Steuern und Abgaben. Während einzelne Faktoren mit der Wahl des Anbieters beeinflusst werden können, bleiben andere Preisbestandteile gesetzlich geregelt und damit fix.
Wie bildet sich der Preis am Strommarkt?
Am Großhandelsmarkt ergibt sich der Strompreis aus der Wechselwirkung zwischen Angebot und Nachfrage. Ein hohes Angebot bei gleichzeitig geringer Nachfrage drückt die Preise, während eine knappe Versorgung bei starker Nachfrage zu Preisanstiegen führt.
Die Strompreisentwicklung Österreich ist dabei eng mit dem europäischen Strommarkt verflochten. Entwicklungen wie die Kosten für Erdgas, die Preise für CO₂-Zertifikate oder auch internationale Handelsbeziehungen wirken sich direkt auf die heimischen Strompreise aus.
Gekauft wird der in Kraftwerken erzeugte Strom entweder im direkten Handel zwischen Erzeuger und Lieferant („Over-the-Counter“) oder an Strombörsen wie der EPEX Spot SE, wo sich Preise nach europäischen Marktmechanismen bilden.

Was ist die Merit-Oder?
Seit der Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 2001 gilt die sogenannte Merit-Order als zentrales Marktmodell. Sie sorgt dafür, dass jederzeit exakt so viel Strom erzeugt wird, wie gerade benötigt wird. Das ist notwendig, um die Netzfrequenz von 50 Hertz stabil zu halten und damit etwaige Stromausfälle zu vermeiden.
Zunächst werden günstige Energiequellen wie Wasserkraft- oder Windanlagen eingesetzt, erst danach teurere Kraftwerke. Dadurch steigen die Kosten, sobald die Nachfrage zunimmt und zusätzliche – meist fossile – Erzeugungsarten benötigt werden. Da erneuerbare Energien jedoch wetterabhängig einspeisen, führen Phasen mit viel Sonne oder Wind oft zu sinkenden Preisen, während längere Windflauten oder trübe Wintertage Preissprünge auslösen können. Politische Entscheidungen wie EU-weite Klimavorgaben wirken ebenfalls auf die Preisbildung ein und können den Markt kurzfristig entlasten oder belasten.
Was sind die Unterschiede zwischen Termin- und Spotmarkt?
Für die Preisbildung sind zwei Handelsplätze entscheidend: Am Terminmarkt wird Strom für die kommenden Jahre gehandelt, was Erzeugern sowie Stromversorgern Planungssicherheit bietet.
Der Spotmarkt hingegen legt kurzfristig die Preise für den nächsten Tag (Day-Ahead) oder sogar für einzelne Stunden desselben Tages (Intraday) fest. Hier wird die Merit-Order besonders deutlich sichtbar: Kraftwerke bieten bei Auktionen ihre Kapazitäten nach Grenzkosten an. Die Börse ordnet die Angebote in aufsteigender, die Nachfrage in absteigender Reihenfolge (Merit-Order-Kurve). So bestimmt das teuerste noch benötigte Kraftwerk den Preis für alle.
Für Haushalte bedeutet das: Auch wenn viele Faktoren nicht direkt beeinflussbar sind, können Konsumentinnen und Konsumenten ihre Energiekosten senken – etwa durch bewusstes Energiesparen oder durch einen Anbieterwechsel über CHECK24. Mit einem Ökostromtarif treiben Sie nicht nur die Energiewende voran, sondern tragen in weiterer Folge auch zu niedrigeren Preisen bei. So lässt sich trotz schwankender Großhandelspreise die eigene Stromrechnung mitgestalten.
Tarife vergleichen und Stromanbieter wechseln:
Wie rechnet sich der Strompreis zusammen?
Für Haushalte und Unternehmen setzt sich der finale Preis auf der Stromrechnung aus drei Komponenten zusammen.
Die Energiekosten werden vom Versorger individuell festgelegt und bestehen aus zwei Teilen:
- Arbeitspreis: Preis je verbrauchter Kilowattstunde (kWh), abhängig von Anbieter und Wohnort
- Grundpreis: fixe jährliche Gebühr, die unabhängig vom Verbrauch anfällt und sich je nach Anbieter unterscheidet
Rabatte, Boni oder staatliche Entlastungen wie die frühere Strompreisbremse können die Energiekosten zusätzlich beeinflussen.
Die Netzgebühren sind gesetzlich geregelt und werden von der Regulierungsbehörde E-Control definiert sowie jährlich angepasst. Sie decken unter anderem die Kosten für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des Stromnetzes sowie für Mess- und Zähleinrichtungen. Bestandteil sind verschiedene Entgelte, darunter Netznutzung, Netzverluste und Messleistungen.
Dieser verpflichtende Anteil des Strompreises geht direkt an den Staat bzw. an die Gemeinden. Er finanziert öffentliche Aufgaben und energiepolitische Maßnahmen. Zu den wichtigsten Posten zählen die Elektrizitätsabgabe, die Umsatzsteuer, die Erneuerbaren-Förderkosten oder regionale Abgaben wie die Gebrauchsabgabe. Die Höhe kann je nach Wohnort variieren.
Weitere Ratgeber zum Thema Energie

Online-Redakteurin
Viktoria stieg unmittelbar nach ihrer Schauspielausbildung und dem Masterstudium in Publizistik- und Kommunikationswissenschaften als Online-Redakteurin bei CHECK24 ein. Sie schreibt über komplexe Finanz-, Versicherungs- und Energiethemen und sorgt dafür, dass Sie alle relevanten Informationen zu unseren Vergleichen erhalten.